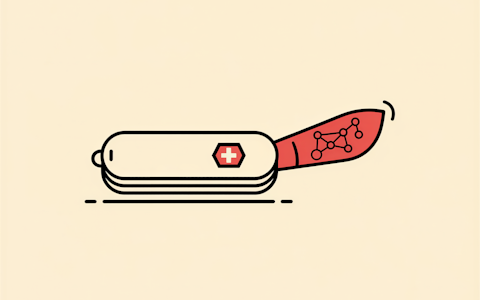Von Inseln zu Communities

Eine kleine Geschichte über Selbstorganisation und Zugehörigkeit
Seit rund sieben Jahren arbeiten wir bei smartive selbstorganisiert. In dieser Zeit haben wir Rollen geschaffen, Entscheidungsprozesse eingeführt – und die Geschäftsleitung abgeschafft. Ein mutiger Schritt damals, getragen von der Überzeugung, dass Menschen Verantwortung übernehmen, wenn man ihnen Raum gibt. Wir glaubten, und glauben bis heute, dass Vertrauen stärker wirkt als Kontrolle.
Was wir damals, mit etwa dreizehn Leuten, nicht gemacht haben: Teams bilden.
Wir haben einfach mit der ganzen Firma unsere Dailies durchgeführt. One company, one team, quasi.
Das war lebendig, transparent und fast utopisch. Aber auch fragil. Denn ohne Grenzen gab es keine funktionale Differenzierung, keine Stabilität.
Zwei Jahre später, mit rund achtzehn Leuten, merkten wir: Unsere Planung wurde immer komplizierter. Wir mussten jede Person einzeln einplanen . Ein Albtraum für Projektmanagement und Sales. Also: Wir brauchen Teams.
Wir zogen mit dem Filzstift Linien rund um die Leute, die ohnehin oft zusammenarbeiteten. Und – tada! 🎉 – wir hatten Teams.
Nur: Das Wort «Team» fühlte sich zu starr an, zu endgültig. Wir wollten Beweglichkeit, nicht Hierarchie.
So entstanden die Inseln. Eine leichte, spielerische Metapher, die gut zu uns passte. Auf einer Insel kann man auch mal wegschwimmen (oder angeschwemmt werden). Die Inseln waren lose Gruppierungen. Keine Sonderrechte, keine festen Grenzen. Und das funktionierte erstaunlich gut. Es war fliessend, flexibel, organisch. Ganz im Sinne unserer selbstorganisierten Kultur.
Ein paar Jahre später waren wir 28 Leute. Zwei Lockdowns vergangen, zwei Standorte dazugekommen. Und plötzlich sassen nicht mehr alle beieinander. Dazu kam: Die wirtschaftliche Situation wurde angespannter. Einige hatten weniger Arbeit und fühlten sich isoliert.
Erfahrene Entwickler*innen sprangen von Insel zu Insel, um Engpässe zu füllen. Kurzfristig effizient, langfristig zermürbend. Wir waren beweglich, ja. Aber irgendwie nicht mehr verbunden.
Rückblickend war hier ein zentrales Ordnungsprinzip (nach Sparrer & Varga von Kibéd) verletzt: das Recht auf Zugehörigkeit. In jeder lebenden Organisation braucht jede Person einen Ort, an dem sie dazugehört. Auch dann, wenn sie gerade nichts leistet. Wenn dieses Prinzip fehlt, verliert das System Energie, Orientierung und Vertrauen. Genau das passierte uns.
Also veränderten wir die Struktur. Und jeder Relaunch braucht ja auch ein Rebranding. Darum:
Aus Inseln wurden Communities. 🥁
Das war kein einfaches Rebranding, sondern eine echte Neuausrichtung: weg von funktionaler Gruppierung, hin zu sozialer Verankerung. Heute gilt:
- Die Community ist dein soziales Zuhause.
- Sie ist selbstorganisiert und trifft Entscheidungen eigenständig.
- Sie führt sich mit Leadership-Prinzipien und wählt eine*n Delegate für die Koordination mit anderen Communities.
- Sie umfasst alle für Projekte nötigen Rollen.
- Sie ist ökonomisch eigenverantwortlich.
Den letzten Punkt, die finanzielle Eigenverantwortung, haben wir wieder gestrichen. Wir sind halt (noch) nicht Buurtzorg. 😄 Der Fokus liegt klar auf dem ersten Prinzip: Die Community ist dein Zuhause, dein Sounding Board, dein Auffangnetz.
Mit den Communities sind wir, einen Schritt weitergegangen. Strukturen dienen bei uns heute weniger der Steuerung, sondern der Selbstführung und Sinnorientierung.
Wenn ich auf unsere Entwicklung zurückblicke, sehe ich drei Phasen:
- Integration (One team): hohe Kohärenz, wenig Differenzierung.
- Differenzierung (Inseln): viel Beweglichkeit, aber soziale Fragmentierung.
- Re-Integration (Communities): Zugehörigkeit auf Basis von Selbstorganisation.
Diese Bewegung ist kein Fehler, sondern der natürliche Rhythmus einer lebendigen Organisation: das ständige Ausbalancieren zwischen Autonomie und Verbundenheit. Die Community-Struktur schafft Räume für beides: Selbstreferenz, weil Communities ihre Themen, Rollen und Entscheidungen selbst steuern, und Fremdreferenz, weil sie über Delegates miteinander verbunden sind.
Wie autonome Zellen in einem grösseren Organismus.
Selbstorganisation ist kein Zustand, den man erreicht. Es ist ein fortlaufendes Aushandeln zwischen Struktur und Autonomie. Unsere Inseln waren ein notwendiger Zwischenschritt . Sie ermöglichten Beweglichkeit, nahmen aber Zugehörigkeit. Unsere Communities bringen Zugehörigkeit zurück, ohne die Selbstorganisation zu verlieren.
Vielleicht ist das genau der Kern von systemischem Denken in Organisationen: Nicht die «richtige» Struktur zu finden, sondern immer wieder herauszufinden, welche Ordnung jetzt gerade trägt und welche nicht mehr.
Diese Gedanken begleiteten mich übrigens auch in meinem CAS in «Change Management, Organisationsentwicklung & -beratung». Dort wurde mir noch einmal klar, wie sehr Theorie und Praxis sich gegenseitig spiegeln: Organisationen sind keine Maschinen, die man einstellt, sondern lebende Systeme, die lernen, sich selbst zu verstehen.
Wir wissen nicht, ob die Communities ewig bleiben. Vielleicht brauchen wir in drei Jahren wieder etwas Neues. Aber genau das ist der Punkt: Strukturen sind nicht dafür da, ewig zu halten. Sie sind Werkzeuge, um Zusammenarbeit jetzt möglich zu machen.
Solange wir neugierig bleiben und bereit sind, Dinge zu hinterfragen, bleiben wir lebendig. Als Organisation und als Menschen.
«Systeme sind lebendig, solange sie in Bewegung bleiben und ihre Bewegungen anerkannt werden.»

Geschrieben von
Robert Vogt